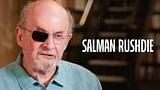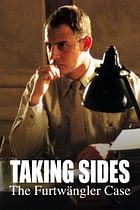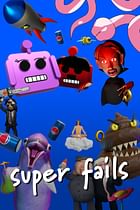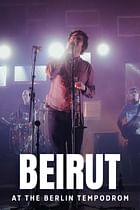ARTE, the European culture TV channel, free and on demand

Portugal
Carnations against Dictatorship
On the night of 24 April 1974, a peaceful uprising put an end to the Salazar dictatorship, paving the way for a democratic Portugal.
Highlights
Unmissable
NotVisible